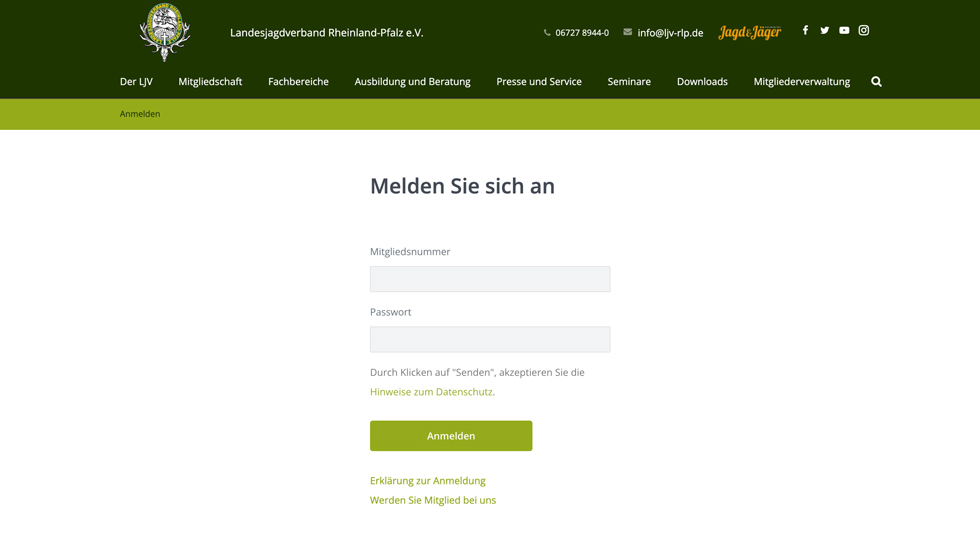Grundsätzlich ist der Schutz unserer heimischen Arten durch verschiedene Regulationsmechanismen möglich. Wir müssen dabei alle auf den Erhaltungszustand einer Art einwirkenden Faktoren berücksichtigen.
Neobiota sind Tiere (Neozoen) und Pflanzen (Neophyten), die nicht in unsere Ökosysteme gehören und auch als invasive oder eingewanderte Arten beschrieben werden. Grundsätzlich gilt hier die Entdeckung Amerikas (1492) und der damit einhergehende Ressourcentransfer als Orientierungspunkt, resp. als Stichtag die Einfuhr der Tiere bzw. Pflanzen. Waren diese bereits vorher in Europa, gelten sie als heimisch; danach als neobiot.
Die EU hat in ihrer Verordnung Nr. 1143/2014 über invasive Arten insgesamt über 60 Tier- und Pflanzenarten gelistet, welche möglichst ausgerottet werden sollen, da sie in extremer Auswirkung die heimischen (indigenen) Arten bedrohen.
Bekannte Beispiele sind der giftige Riesenbärenklau oder das sich schnell ausbreitende Drüsige Springkraut und bei den Tieren vor allem der Waschbär.
Invasive gebietsfremde Arten (IGA) gefährden heimische Ökosysteme:
Raubsäuger aus anderen Faunenräumen, wie Marderhund, Waschbär und Mink treten zusätzlich zu heimischen Fressfeinden wie dem Fuchs oder den Marderartigen auf. Gemeinsam mit ihnen erhöhen sie den Prädationsdruck auf heimische Beutetiere: sie können insbesondere für isolierte Restpopulationen bestandsbedrohend sein.
Neue Arten können die Verbreitung von Krankheiten und Parasiten fördern, indem sie als zusätzliche Überträger auftreten. Beispielsweise ist er Marderhund Träger und Verbreiter des Kleinen Fuchsbandwurms und der Waschbär ist Träger des Waschbärspulwurms. Dies kann Auswirkungen sowohl auf den heimischen Wildtier- und Haustierbestand als auch auf die menschliche Gesundheit haben.
Vermehrungs- und ausbreitungsstarke Arten können zu Konkurrenten heimischer Arten werden. An Uferböschungen, wo z.B. das Indische Springkraut wuchert, haben heimische, feuchtigkeitsliebende Pflanzen keine Chance, zu wachsen. Beispielsweise blockiert die Rostgans Nistkästen für Turmfalke und Schleiereulen und verdrängt damit diese heimischen Arten aus angestammten Brutgebieten.
Auch durch eine Bastardisierung können Arten in ihrem Bestand gefährdet werden. In diesem Sinne ist z.B. die aus Nordamerika stammende Schwarzkopfruderente der Hauptbedrohungsfaktor für die südeuopäische Population der Weißkopfruderente.
IGA verursachen ökonomische Schäden:
Kosten entstehen durch Fraßchäden an Kulturpflanzen, Beschädigung von Gebäuden, aber auch durch gezielte Bekämpfungsmaßnahmen zum Eindämmen oder Entfernen der fremden Arten.
Beispielsweise führt der steigende Bestandstrend der Kanadagans auf Grünland- und Wintergetreidestandorten vermehrt zu Fraßchäden. Darüber hinaus werden Parkanlagen und Badeplätze verschmutzt. Im Zeitraum von 2001 bis 2013 sind dem Bundesland Oberösterreich durch Monitoring- und Bekämpfungsmaßnahmen für den Asiatischen Laubholzbockkäfer Kosten in Höhe von zwei Millionen Euro entstanden.
Gesetzliche Vorgaben regeln den Umgang mit IGA:
Internationale Ebene
Die am 1.1.2016 in Kraft getretene EU-Verordnung Nr. 1143/2014 zur “Prävention und Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten” enthält Bestimmungen für die Prävention, die Eindämmung und die Eradikation sowie zum Schutz der Biodiversität in Europa.
Die Biodivesritätskonvention (CBD: Convention on Biological Diversity) aus den Jahren 1992, 2000 und 2002 legte den Grundstein zur Bewahrung heimischer Artenvielfalt und verpflichtet die internationale Staatengemeinschaft, Vorsorge gegen invasive Arten zu treffen und diese Arten ggf. zu bekämpfen.
Nationale Ebene
Das BNatSchG (Stand 2010) regelt in § 40 den Umgang mit gebietsfremden Arten und berücksichtigt dabei den auf dem Vorsorgeprinzip beruhenden dreistufigen, hierarchischen Ansatz der CBD.
Quelle: Deutscher Jagdverband
Kulturfolger wie Fuchs, Steinmarder, Waschbär und Wildschwein kommen in den von Menschen geschaffenen Lebensräumen bestens zu Recht. Neben günstigen klimatischen Bedingungen, zahlreichen Deckungsmöglichkeiten und Rückzugsräumen bieten urbane Räume ein breites Futterangebot und bergen zudem kaum Fressfeinde.
Wie mit Kulturfolgern umgegangen werden kann, die im heimischen Garten oder gar im Haus ihr Unwesen treiben, zeigt die Broschüre “Wilde Wohngemeinschaft – Wildtiere in der Stadt”.
Als in den 1990er Jahren die Bestandszahlen beim Kulturfolger Rotfuchs ausuferten, bediente sich die Natur eines einfachen Mechanismus: Krankheiten, in diesem Fall die Tollwut, sorgen i.d. R. durch eine starke Dezimierung für die dem Lebensraum angepassten Bestände. Auf Grund der negativen Auswirkungen auf andere Tiere und den Menschen (Tollwut = zoonotisch, den Menschen ansteckend) wurden jedoch Impfköder ausgebracht und die Füchse somit immunisiert.
In der Folge stiegen die Fuchsbestände extrem an und die klassischen Niederwildarten (Rebhuhn, Hasen, etc.) standen unter enormen Druck durch die Prädation der Füchse. Bis heute konnten sich diese Arten nicht davon erholen. Das Rebhuhn ist heute sehr stark in seinem Bestand gefährdet.
Wer sich konteporär gegen die Bejagung/Regulierung des Rotfuchses ausspricht, denkt einseitig. Moderner Artenschutz kann nur unter ganzheitlicher Betrachtung funktionieren.
Bei diesem Thema wird auch klar, dass der klassische Tierschutzgedanke nicht den Mechanismen eines effektiven Artenschutzes entspricht.
Luchs und Wolf: unterschiedliche Lebensraumansprüche
Luchs und Wolf sind hinsichtlich ihrer Lebensraumansprüche, ihrer Jagdweisen und ihres Beutespektrums, aber auch im Hinblick auf zu erwartende Nutzungskonflikte zwei völlig unterschiedliche Tierarten. Ferner unterscheiden sie sich auch, was die ökologische und rechtliche Bewertung betrifft. So ist der Wolf zwar – wie der Luchs – streng geschützt; er unterliegt aber nicht dem Jagdrecht und den sich daraus ergebenden Verantwortlichkeiten.
Der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz (LJV) ist der Meinung, dass die Lebensräume in Rheinland-Pfalz für den Aufbau von eigenständigen Wolfspopulationen für gänzlich ungeeignet ist. Die sich aus einer Zuwanderung ergebenden Problemlagen für den Wolf selbst und den Menschen hält der LJV – unabhängig von jagdlichen Interessen – für noch wenig durchdacht. Dennoch – oder vor allem deshalb – braucht Rheinland-Pfalz bereits heute einen flexiblen Wolfsmanagementplan, der Jäger*innen und andere Betroffene in die Lage versetzt, mit den hierzulande zunehmend durchziehenden Einzelwölfen fachlich richtig umgehen und sichere, abgestimmte Entscheidungen treffen zu können. Deshalb bringt sich der LJV konstruktiv kritisch beispielsweise in den “Runden Tisch Wolf“ beim Ministerium ein.
Hier finden Sie die Positionen des LJV zu Wolf und Luchs: